Carlo Masala über die Bundeswehr: „Ich will eine wehrhafte Demokratie“
Politikwissenschaftler Carlo Masala ist als Militäranalyst präsent wie fast niemand. Er macht sich stark für eine diverse, woke und bewaffnete Armee.

Wir treffen uns morgens um 8 Uhr. Carlo Masala lebt in Leipzig. Auf die Frage, wie viele Tweets er schon lanciert hat, antwortet er: „Nur zwei.“ Aus dem Wohnzimmer kommt leise Jazz. Im Flur stehen Musikinstrumente, er spielt selbst viel. Er serviert Stempelkaffee, er redet, wie er bei Fernsehauftritten spricht: erfrischend offen, wach.
taz am wochenende: Herr Masala, die Bundeswehr hat nach wie vor in linken Kreisen keinen guten Ruf. Nach den bekannt gewordenen Fällen rechtsradikaler Sympathisantenschaften kann es auch gar nicht anders sein, oder?
Carlo Masala: Es gibt diese rechtsextremistischen oder rechtsradikalen Soldaten in der Bundeswehr, ja. Aber wenn man die ganze Bundeswehr nimmt, ist ihre Anzahl dann doch klein. Das heißt nicht, dass nicht jeder einer zu viel ist, aber ihre Anzahl ist vergleichsweise geringer als in der deutschen Gesellschaft insgesamt. Aber sie dominieren zeitweise das öffentliche Bild.
Der Militärhistoriker Sönke Neitzel sagt, die Bundeswehr solle man ohnehin nicht allzu sozialpädagogisch handelnd sehen. Sie sei ein Militärkorpus.
Tatsächlich gibt es die Bundeswehr, die bei der Coronapandemie extrem viel geholfen hat, im Ahrtal bei den Hilfen für die Flutopfer war sie auch segensreich präsent. Aber richtig ist auch, dass es in der Bundeswehr archaische Rituale gibt und auch braucht. Ein großer Fehler in den vergangenen Jahrzehnten war, dass die Politik nie den Kernaspekt der Armeen thematisiert hat.
Und der wäre?
Der dreckige Kernaspekt von Armee, nämlich dass es darum geht, auch gegebenenfalls unter gewissen Umständen zu töten beziehungsweise getötet zu werden. Darüber sprach man nicht, weder die Generalität noch die Politik.
Auch nicht, als die Bundeswehr in Afghanistan Station bezog.
Ich kenne das noch aus der Zeit, wo ganz, ganz viele meiner Absolventen an der Universität nach Afghanistan gegangen sind. Mit vielen habe ich Kontakt gehalten, und vielen von denen, die ich für sehr gute Studierende und Soldatinnen gehalten habe. Dann kamen sie zurück und haben gesagt: Nee, ich werde kein Berufssoldat.
Warum?
Sie sagten, sie hätten das Gefühl gehabt, dort etwas zu machen, was hier in dieser Gesellschaft, in der Heimat verschwiegen wird. „Und dazu habe ich keine Lust, das für den Rest meines Lebens zu machen.“ Sie wollten einen Beruf, zu dem sie nicht nur stehen können, sondern der auch nicht gesellschaftlich beschwiegen wird.
Ist diese politische Entwicklung, auf die Kanzler Scholz seit Ende Februar mit seiner Rede von der „Zeitenwende“ reagiert hat, so neu?
Sie begann mit dem Fall der Mauer. Wir hatten vorher eine Armee, die für einen hypothetischen Fall trainiert hat, der nicht eingetreten ist, Gott sei Dank. Es begann die Zeit der Auslandseinsätze, aber schon unter Kanzler Kohl galt, die Bundeswehr wird lediglich als ein bewaffnetes Technisches Hilfswerk verkauft. Wir gehen raus und tun Gutes. Also kein großer Unterschied zu Brot für die Welt oder zu anderen, halt nur mit einem G36-Sturmgewehr in der Hand. Aber die Aufgaben sind sozusagen die guten Aufgaben.
Das hat sich ja offenbar geändert.
Das Militär an sich ist nicht mehr umstritten, das ist Konsens der Parteien, abgesehen von der AfD und der Linken. Es geht nicht mehr um die Frage, ob wir militärische Macht brauchen – sondern ob bestimmte Einsätze Sinn machen oder nicht.
Viele Soldat*innen, die aus Afghanistan heimkehrten, beklagten, dass die Mission, die sie erfüllen sollten, Menschenrechte durchzusetzen beispielsweise, durch den Rückzug aus dem Hindukusch verraten wurde. Die das sagten, sind politisch superempfindsame Männer und Frauen.
Die Bundeswehr hat einen langen Weg hinter sich. Noch vor wenigen Jahren hat man sich um die Soldat*innen, die mit einer posttraumatischen Belastungsstörung versehrt zurückkamen, kaum gekümmert. Man dachte, so wie einst, ach, diese Erschütterungen, die geben sich. Nein, wir haben gelernt, dass die nicht einfach weggehen. Über 20 Jahre wurden 60.000 Soldat*innen nach Afghanistan geschickt – aber wir haben keine Erinnerungskultur für sie und ihren Einsatz geschaffen. Wir haben über diesen Einsatz geschwiegen.
Ist das eine Folge der nationalsozialistischen Gewaltjahre – dass man das Militärische in der Bundesrepublik lieber unerwähnt lässt?
Politiker*innen glaubten immer, dass etwa Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht populär sind, dass sie politische Zustimmung kosten. Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist nichts, was Menschen in ihrem tagtäglichen Leben berührt. Aber wenn ich Zustimmung für diese politischen Bereiche, auch Auslandseinsätze haben will, muss ich dafür werben. Das sollte genauso normal sein wie Debatten um irgendwelche Gasumlagen. Ich kann den Fernseher nicht mal einschalten, ohne dass mir nicht die gesamte Riege von Regierung und Opposition über den Weg läuft und erklärt, warum das richtig, gut, falsch oder wie auch immer ist.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.
Sie sind in Köln als Kind von sogenannten Gastarbeitern aufgewachsen und haben, wie es so heißt, nicht gedient. Würden Sie heutzutage?
Damals hätte ich verweigert. Ich bin damals, schulisch geprägt, in einem linksliberalen Milieu aufgewachsen. Hätte ich damals gewusst, dass die Bundeswehr auch ein Studium, eine Ausbildung finanziert, wäre das für mich interessant gewesen.
Ein Lockmittel, das Studium.
Warum auch nicht? Alle Großorganisationen werben mit allen möglichen Benefits.
Waren Sie, generationstypisch, Pazifist?
Nein, nie. Ich habe auch damals die Funktion von Armeen eingesehen.
1982, zu den Hochzeiten der bundesdeutschen Friedensbewegung, gab es im Bonner Hofgarten die legendäre Demonstration gegen die Nato-Nachrüstung. Waren Sie dabei?
Nein, ich war noch zu jung. Viele meiner Bekannten und Freunde waren aber dabei.
Jene, die diese Jahre erlebt haben, sprechen von einer Zeit der Angst vor atomarer Zerstörung. Hatten Sie die auch?
Nie. Ich hatte nie Angst vor diesem nuklearen Armageddon. Ich bin nicht jeden Tag glücklich drüber aufgewacht, dass am Ende der Nacht keiner die Atombombe geschmissen hat.
„Frieden schaffen ohne Waffen“, hieß es, unter anderem.
Ist totaler Unsinn. Das wird nicht funktionieren. Wir leben in einem internationalen System, in dem das große Problem für Staaten ist, dass keiner für ihre Sicherheit sorgt. Und deshalb müssen Staaten für ihre Sicherheit selbst sorgen. Und die Vorstellung, dass man eine Welt ohne Waffen hat und dass sich jeder daran hält, ist illusorisch. Wir sehen ja so viele Täuschungsversuche in der internationalen Politik. Wie soll garantiert werden, dass eine Welt ohne Waffen existiert und fortbesteht?
Der Mann
Carlo Masala, 54, ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Aufgewachsen ist er als Gastarbeiterkind in Köln – Vater Italiener, Mutter Österreicherin. Sein Twittername lautet: Carlo „Realism, Gedankenfetzen, and Rants“ Masala. Er lebt in Leipzig, und er berät das Bundesministerium für Verteidigung.
Das Buch
Soeben in neuer Auflage erschienen: „Weltunordnung. Die globalen Krisen und das Versagen des Westens“ (C. H. Beck Verlag, München 2022, 199 S., 16,95 Euro).
„Schwerter zu Pflugscharen“ – hätte dieses DDR-Credo etwas für Sie sein können?
Das war der Beginn einer Bewegung, die am Ende zum Kollaps der DDR führte. Ich bin Gegner von überdrehten Rüstungsspiralen. Warum hatten die Sowjetunion und die USA sich damals auf das jeweils siebenfache Potenzial der gegenseitigen Vernichtung geeinigt? Ich dachte mir schon während meines Studiums, dass das nicht logisch ist. Die jeweils einmalige Vernichtung würde doch reichen – wozu die siebenfache Möglichkeit?
Es war eine hochgefährliche Situation – aber eine im sogenannten Kalten Krieg, der im Unterschied zum Heißen Krieg nicht wirklich beginnt.
Der Unterschied zu heute ist nur, dass die Sowjetunion eine Status-quo-Macht war, der es in Europa also darum ging, das Bestehende zu erhalten, nicht zu erweitern. Russland hingegen ist eine revisionistische Macht. Und deswegen wird dieser Kalte Krieg 2.0, in den es zumindest auf einer europäischen Ebene hinausläuft, nicht stabiler sein als der, der 1990 endete, sondern unberechenbarer sein als der Kalte Krieg.
Hat sich eigentlich das Bild von Männlichkeit im Laufe Ihres Lebens geändert?
Bei mir persönlich ja. Aber nicht bedingt durch die Bundeswehr. Ich sehe jetzt zum Beispiel wieder die Gefahr, wo wir in so einem Landes- und Bündnisverteidigungsszenario sind, dass wir die praktischen Fragen nicht geklärt kriegen: Wie bekommen wir gegebenenfalls große Teile der Truppe in vier Tagen von hier nach Irgendwo verlegt?
Ist das eine Frage toxisch-männlicher Tugenden?
Nein, aber seit einiger Zeit schleicht sich in die Bundeswehr wieder diese Kultur toxischer Männlichkeit ein – und dabei müsste es, wie ich sagte, um konkrete militärpraktische Fragen gehen.
Die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich in der Bundeswehr keinen guten Ruf eingehandelt, weil sie Fragen aufwarf, die in dieser Szene nicht üblich sind zu stellen: Frauenteilhabe an der Bundeswehr, Soldaten und Vätermonate, homosexuelle und trans Soldat*innen …
… ihr großes Verdienst war es zumindest, dieses Tor zur Diversität in der Bundeswehr geöffnet zu haben. Und meine große Befürchtung ist, dass in der Bundeswehr Kräfte stärker werden, die dieses Tor gerne wieder schließen würden. Dass überhaupt trans Leute in der Bundeswehr sein können, dass Homosexualität kein Nichtthema ist, sondern, wie die restaurativeren Kräfte sagen, überbetont wurde.
Die Bundeswehr könnte doch öffentlich bekunden, stolz auf dieses Selbstverständnis als diversitätsbewusste Armee zu sein.
Ja, das sollte sie auf jeden Fall, macht sie aber nicht. Und das halte ich für einen großen Fehler. Wir wissen es ja auch wissenschaftlich, dass Armeen umso besser sind, wie sie die Diversität ihrer Gesellschaften widerspiegeln, und zwar komplett, sei es sexuell, sei es religiös. Eine militärische Großorganisation wie die Bundeswehr sollte keine Armee der Spartaner sein, mit entsprechendem Elitebewusstsein. Wie soll die funktionieren, wenn sie den Staat und die Gesellschaft, die sie verteidigen, aus ihrer Eliteposition verachten.
Ist Virilität noch an Männliches geknüpft, können auch Soldatinnen viril sein?
Ich kenne Soldatinnen. Die einen sind Mütter, andere sind Lesben, wiederum andere ohne Kinder. Wenn die auf dem Kasernenhof stehen, wenn die ihre sportliche Leistungsfähigkeit bringen, wenn es darum geht, Zähne zusammenzubeißen und durchzuziehen: 80 Prozent aller Typen lassen die hinter sich. Mehr muss man dazu nicht sagen.
In der Ukraine, so wissen wir, kämpfen queere Menschen gegen die russischen Angreifer. Sie melden sich an der Front, sind hochrespektiert. Ist das nicht ein Vorbild – so wie es auch in der israelischen Armee üblich ist?
Ja, absolut. Ich will eine Bundeswehr, die woke im besten Sinne des Wortes ist, wehrhaft und bis an die Zähne bewaffnet. Ich will eine wehrhafte Demokratie, und ich will auch eine Armee, die die Diversität dieser Gesellschaft widerspiegelt.
Trauen Sie das den höheren Ebenen der Bundeswehr zu, für solch ein modernes Verständnis von Diversität einzutreten?
Das muss politisch verordnet werden, sonst tut sich wenig, die erreichten Fortschritte bleiben sonst stecken.
In den Niederlanden, in Israel werben die Armeen auf CSD-Paraden für sich – mit dem Selbstbewusstsein, Angehörige von Armeen der Diversität zu sein.
Ja, das ist erschütternd, dass das bei uns nach wie vor kein offensiver Punkt ist. Bundeswehr mit mächtigem Auftritt auf CSDs oder auf queeren Straßenfeste? Ist nicht der Fall. Das ist sehr schade, und es schadet der Bundeswehr, denn sie bringt sich um Chancen und um Personal, das sie dort werben könnte.
Brauchen wir wieder eine Wehrpflicht?
Sie war gut, aber jetzt wäre sie es nicht. Sie ist sicherheitspolitisch nicht ableitbar. Wir werden keine sechs russischen Panzerdivisionen in absehbarer Zeit an der deutsch-polnischen Grenze haben. Der Krieg des 21. Jahrhunderts ist nicht der Krieg, der gerade im Donbass geführt wird. Die Russen würden einen anderen Krieg gegen uns führen. Da braucht man keine Massenheere, da brauchen wir Profis, die bestens ausgebildet sind.
Die Bundeswehr, so hieß es früher, sei die Schule der Nation.
So ein Quatsch. Alles, was militärisch wichtig ist und wird, ist mit einem Durchlauferhitzer namens Wehrpflicht nicht zu haben. Jene, die ihre Wiedereinführung fordern, sind am Ende Sozialpolitiker, die damit auch gleich den Zivildienst wiederbekommen wollen. Oder es sind Nostalgiker, die das befürworten.
Woher holt die Bundeswehr auf leerer werdenden Arbeitsmärkten ihr Personal?
Ich bin dafür, dass diejenigen, die hier geboren wurden, aber keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, rekrutiert werden können. So eine Art Modell wie in den USA. Verpflichte dich für x Jahre, und du gehst raus mit deutschem Pass. Das ist der richtige Weg. Wir würden die Bundeswehr zu einer wesentlich größeren Integrationsmaschine machen, als sie ist.
Eine Idee, die in konservativen Kreisen Ärger macht, oder?
Wahrscheinlich.
In Ihren zahlreichen Tweets gehen Sie ja auch keinem Ärger aus dem Weg. Sie nannten eine, die Sie blöde anging, „Mausebärchen“ …
Das geht immer: So ein bisschen verniedlichen, das bringt die auf die Palme, und das freut mein sportliches Gemüt.
Sie wären beim Sport auch so?
Ich war beim Taekwondo auch immer besser im Angriff als in der Verteidigung, obwohl das von der Logik des Taekwondo doof ist.
Warum?
Ich bin ja wesentlich ruhiger geworden die letzten zwanzig, dreißig Jahre. Aber der Modus, den ich immer habe, ist: Attacke. Wer den ersten Schlag vernichtend setzt, gewinnt alles.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen





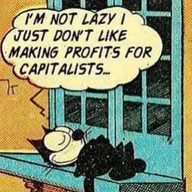





meistkommentiert